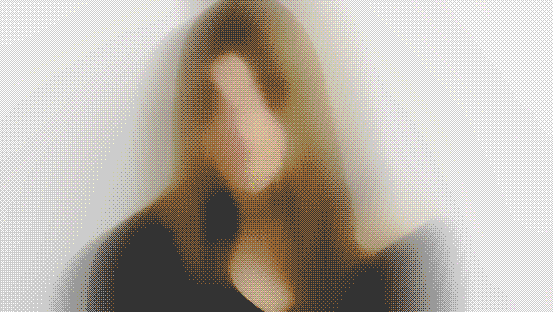
Verfolgungsjagd nach dem Jungstar der neuen deutschen Literaturszene: Helene Hegemann steht im Rampenlicht und ist davon geblendet.
Helene Hegemann, eine 17jährige, die mit ihrem Roman „Axolotl“ die Bestsellerlisten stürmt, hat gleich einige Diskussionen im Feuilleton der deutschen Medien ausgelöst und damit vieles über die Themen „Authentizität in der Literatur“, „Erlebnisarmut“ und „Abschreiben als Kunstform“ offenbart.
Es kommt einem so vor, als hätte sie wie im Jazz das Grundthema geliefert, über das nun eine Heerschar an Solisten phrasiert bzw. das Thema facettenreich interpretiert. Das Wesentliche im Moment ist nicht das Hauptgericht, das Buch „Axolotl Roadkill“, sondern kübelweise Senf, den viele hinzugeben.
Erkenntnisprozess: Ein Medienhype als Indikator
Es zeigt sich im Augenblick viel: Die händeringende Suche nach möglichst jungen Talenten, die mit dem Genialitäts-Gen ausgestattet sein müssen. Die Überforderung der Literaturkritik, mit Remix-Herangehensweisen umzugehen, die aber eigentlich nicht neu sind. Die Verlogenheit der Troika „Autor, Verlagswesen und Literaturkritik“, die alle voneinander leben. Vor allem aber: Die allgemeine Erlebnislosigkeit, der Youngster nur noch durch Exzess-Plots in ihren Büchern gerecht werden können.
Leise Töne: Das Ende der Nuancen?
Das wurde 1994 im Roman „Ausweitung der Kampfzone“ des Franzosen Michel Houellebecq deutlich, führte über Charlotte Roches „Feuchtgebiete“ (2008) oder jetzt zu „Axolotl Roadkill“. Allen drei Büchern ist ein Trashfaktor gemein, auch wenn sie formal echte Literatur sind. Aber wovon handeln sie? Was passiert in ihnen? „Ausweitung der Kampfzone“ liest sich wie ein innerer Monolog über die Aussichtslosigkeit des Miteinanders von Mann und Frau, „Feuchtgebiete“ in der Rahmenreflexion wie ein Sexual- und Hygiene-Lexikon und „Axolotl Roadkill“ wie ein Murmelspiel mit schlimmen Stellen. Der Verlag wird dem Roman ab der nächsten Auflage einen sechsseitigen Anhang mit Quellenangaben hinzufügen, damit das Sampling richtig deutlich wird. Und wo sind die leisen Töne? Sind sie untergegangen im Anhäufen von gewaltigen Wort- und Fuckup-Kaskaden? Letztlich muß also nun Helene Hegemann daherkommen, die sich in den Medien etwas ungelenk und altklug geriert und der man die Revolution nicht abnimmt, weil man merkt, dass vieles nur angelesen und nicht selbst erlebt ist.
Wer schreibt über das Erlebte, wenn es nichts zu erleben gibt?
Das ist der Unterschied zu vergangenen Zeiten: Als es den Menschen dreckig ging, hatten sie was zu erzählen. Authentizität war da nicht das Thema, weil selbstverständlich und vielleicht sogar lebenserhaltend. Inzwischen ringen mehrere Generationen junger oder jüngerer AutorInnen darum, etwas zu sagen zu haben. Andererseits verharren gestandene Literaten der Marke Gras oder Walser meist aber auch in ihrem angestammten Themenkanon anstatt etwas Neues zu bringen, weil sie kaum noch etwas erleben. Verständlich, wenn man alt ist, bedenklich, wenn man jung ist.
In welcher Tradition steht „Axolotl Roadkill”?
Man vergleiche mal Goethes Erstlingsroman „Die Leiden des jungen Werther“ von 1774 – der immerhin auf seine Leser so viel Einfluß nahm, dass die sich reihenweise selbst töteten – mit „Der Fänger im Roggen“ von J. D. Salinger (1951) oder eben mit einem Buch wie „Axolotl Roadkill“ (2010). Man könnte jetzt entgegnen, das ließe sich nicht vergleichen, auch wenn das alles Erstlinge sind. Gut: Stellen wir „Axolotl Roadkill“ meintwegen dem ersten Soloroman von William S. Burroughs (1953) gegenüber. Sein Werk „Junkie“ brach mit allen Konventionen, war tatsächlich revolutionär. Es verarbeitete Erlebtes und Imaginiertes, jedenfalls stand es in Bezug zum Leben. Der Autor hat nicht irgendwas gegoogelt, er hat sich nicht Theoretisches angelesen und das repetiert, nein, er hat am eigenen Leib Erlebtes verarbeitet und aus dem Erlebten seine Sichtweisen und Theorien abgeleitet.
Plagiate im Dienst des Höheren
Das moderne Remix-Collagieren kann zur reinen Addition von Informationsschnipseln werden, die nur Schale ohne Kern sind. Ist es richtig, der Informationsflut beizukommen, indem man brav Zitat an Zitat fügt und das Remix-Literatur nennt? Nö! Und die Medienkritiker schleichen auf dem Pfad entlang, ob das ein Plagiat sei, wenn man sich überall bediene. Wohl kaum: Thomas Mann hat seitenweise aus Lexika abgeschrieben und auch Bertolt Brecht mußte sich in einem Plagiatsprozess der Thematik erwehren. Es muß heute beim Ausleihen und Klauen in erster Linie darum gehen, ob das der richtige Weg ist, auf die Erfordernisse des Informationssperrfeuers adäquat zu reagieren.
Auf der Suche nach den Jung-AutorInnen
Die Literaturkritik ist auf der Suche nach jungen und anspruchsvollen aber vor allem auch massenkompatiblen und erfolgreichen Autoren und mißt vereinzelten Überfliegern viel mehr bei, als wirklich dahinter steckt. Benjamin von Stuckrad-Barre einen Autoren zu nennen ist ziemlich weit hergeholt, seine Bücher „Soloalbum“ von 1998 oder „Remix“ von 1999 sind ein Beispiel für einen Trendsurfer, der auch mal im Deutschunterricht saß und einen Computer mit Word bedienen kann. Die maingestreamten Medien sinnierten damalig weniger über seine Stilistik und mehr darüber, ob er mit Anke Engelke tatsächlich im Bett gewesen war. Inzwischen ist von Stuckarde-Barre Mitte Dreissig und Mitglied der Rolling Stone-Redaktion.
Die qualitative Sperrspitze des Erfolgs: Christian Kracht, Daniel Kehlmann und Judith Hermann
Kollege Christian Kracht hatte mit „Faserland“ (1995) und „1979“ (2001) schon mehr zu bieten. Die Kritik hat ihn für würdig befunden. Der mit „Die Vermessung der Welt“ erfolgreichste von allen Jungen, Daniel Kehlmann, Jahrgang 1975, ist ein Traditionalist. Der Nachfolger seines Megasellers, „Ruhm“, kann nicht anders als auf eine zugegebenermaßen intelligente Art die Schicksale eines berühmten Autors zu behandeln. Oder Judith Hermann, die vielleicht größte Hoffnung mit ihrem „Sommerhaus, später“: Sie hat sich einer völligen Innerlichkeit verschrieben und tut gar nicht erst so, als würde sie irgendetwas erleben. Kracht gehörte wie von Stuckrad-Barre zur Sperrspitze des damaligen Pop, beide konnten aus ihrer Erfahrungen mit Pop und der Medienwelt schöpfen.
Am Ende der Erlebniswelt
Apropos „Erlebniswelt“: Durch den ersten und den zweiten Weltkrieg hatte Europa seine Traumata zu verarbeiten, auch literarisch. Der Schrecken des Krieges gab die Themen für ein Jahrhundert vor. Danach waren Armut und soziale Mißstände in Deutschland flächendeckend relativ passé – um den Preis der Saturiertheit, der Langeweile, der Ereignislosigkeit, der Schlaffheit und der Sattheit, die aber immer auch Magersucht erzeugt. Irgendwann gab es nichts mehr zu sagen, weil alles geschrieben und kaum noch etwas zu erleben war. Kritiker, die unken, es gäbe nur noch fade deutsche Literatur, sollten beachten, dass auch das Leben nicht viel anders ist, als die Literatur, die ihm entspringt.
Was gibt es zu durchleben?
Es gibt natürlich immer noch Leidensdruck. Kriege, Erdbeben oder Seuchen finden allerdings anderswo statt. Selbst die Drogen hatten zwischenzeitlich ihren Schrecken verloren und waren intervallweise nicht mehr hip. Doch mit Ecstasy und anderen Designerdrogen wurde es ansatzweise wieder spannend – im literarischen Sinne. Zum Beispiel bei Irvine Welsh, der mit „Trainspotting“ nicht nur ein Drogenbuch über alte Drogen geschrieben hat sondern vor allem eine Sozialstudie.
Das aktuelle Leben: Im Inneren des Bildschirms
Kontrastiert wird die relative Ereignislosigkeit mit ihrem plattgedrückten Ereignishorizont durch die Flut an Eindrücken ganz anderer Art: Es gibt immer mehr Sekundärleben: Filme, Spiele, 3D-Welten, Communities von Menschen, die sich nie treffen, virtuelle Charaktere. Auch Blogger, die ihren Senf dazugeben – zu eigentlich allem, was es zu beobachten gibt. Kein Wunder, dass man die ohne Schuldbewußtsein beklauen kann, weil man sie nicht als reale Personen wahrnimmt. Wie alle anderen sind sie Infonauten, Informations-DJs, -MCs oder -Junkies, die auf digitalen Wellen reiten und einen permanenten Stream absondern. „Copy and Paste“ von Texten bedeutet auch, irgendwann zu vergessen, ob man das selber geschrieben oder irgendwoher kopiert hat. Gerade, wenn mans im Duselkopf gemacht hat – breit vom Rauchen oder aufgekratzt vom Schlucken und Einwerfen. Oder man ist so sehr Egozentriker und denkt, dass alles Wahrgenommene einem sowieso gehört, dass man das Geklaute durch die eigene Auswahl – den Vorgang des Klauens – quasi veredelt.
Theorie anstatt Praxis
Das reale Leben also wird zusehends ersetzt durch Placebos. Anstatt im Winter hart an sich zu arbeiten und draußen zu laufen, macht mans Wii-mäßig kuschlig warm im heimischen Wohnzimmer, anstatt selbst abartig zu sein, schaut man sich abartige Pornos im Netz an. Anstatt etwas zu erleben, über das man schreiben könnte – also: anstatt ein reales Risiko einzugehen – liest und sieht man sich ersatzweise satt und hält das für das wirkliche Leben. Die Theorie wird zur Praxis. Vielleicht, wenn man völlig durchgedreht ist und zu viele Ballerspiele gespielt hat, nimmt man sich Daddys reale Waffen und erstürmt ein Klassenzimmer – oder schreibt ein Buch, das vorgibt, ein wirklicher Roman zu sein. Die Altersgenossen meinen das dann auch und kaufen es. Die Literaturkritik sieht den Erfolg und fällt drauf rein. Und irgendwann hat sich jeder dran gewöhnt, und vielleicht ist es tatsächlich sogar ganz gut, weil es keinen besseren Ausdruck für die Ereignislosigkeit gibt.
Die Perpetuum-Transzendentum-Maschine
Wem ist eigentlich aufgefallen, dass bei Castingshows die Kandidaten Lieder von gecasteten Placebo-Gruppen nachsingen, also sozusagen die Kopie von der Kopie sind, was – im Sinne einer doppelten Verneinung, die dann doch wieder zur starken Bejahung führt – unter Umständen wieder ein ganz besonderes Original ergibt: Eines, das so dermaßen vom Nichts durchwirkt ist, dass es weit über sich selbst hinausweist und sich damit in eine schier unmögliche Perpetuum–Transzendentum-Maschine verwandelt.

One Response to “Lithype: Helene Hegemann und die „Generation Ereignislos“”
[…] Buch „Strobo“ verkaufte durch diese ungewollte Öffentlichkeit und im Sog „Axolotl‘s“ Bestsellerhechelei gleich auch richtig gut. Manche Kritiker ordneten seinen Text als den […]