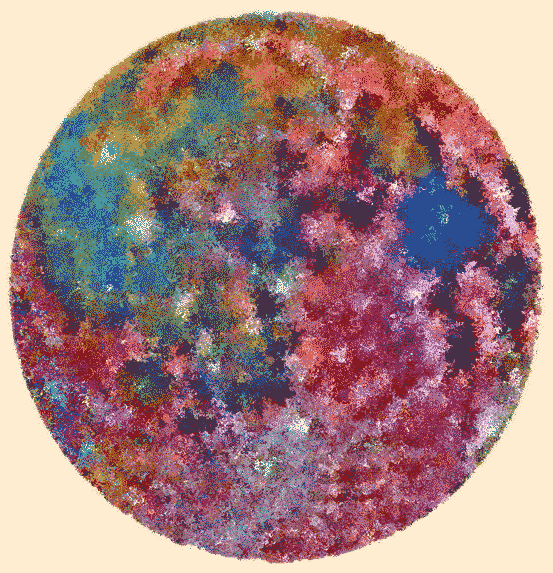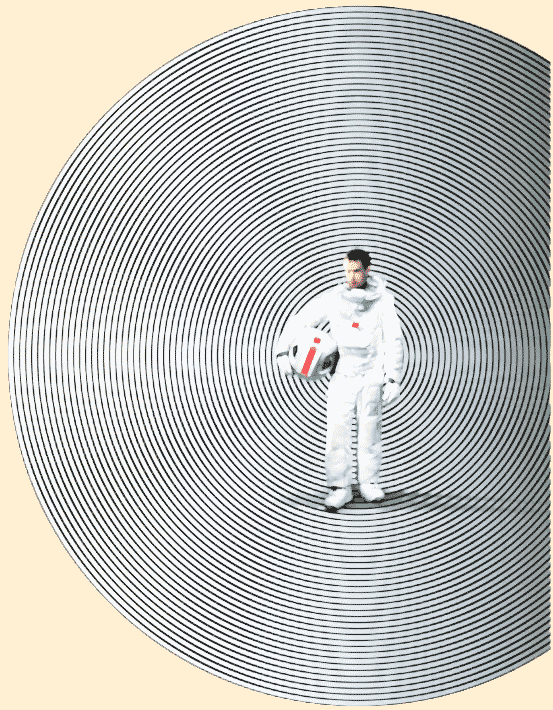Diese Kritik kommt im Grunde eine Woche zu spät, da „Moon“ schon letzte Woche angelaufen ist. Das passt aber wiederum zum Film, denn der kommt auch zu spät, nämlich ein ganzes Jahr nachdem der Rest der Welt ihn schon als DVD im Regal stehen hat. Tja, die Wege der deutschen Verleiher sind unergründlich, seien wir lieber froh, dass der Film doch noch seinen Weg auf die Leinwand findet.
Sam Bell ist seit fast drei Jahren der einzige menschliche Bewohner einer Mondstation, deren Aufgabe es ist, das sogenannte Helium-3 abzubauen, ein Wunderstoff, mit dem man in der Zukunft sämtliche Energieprobleme gelöst hat. Da das weitgehend automatisiert vor sich geht, hat Sam nicht viel mehr zu tun als immer wieder mal nach dem Rechten zu sehen: Die drei Jahre sind ihm entsprechend lang vorgekommen – trotz des Computers „Gertie“ der als Sams Ansprechpartner agiert.
Die Aussicht auf das Ende der Einsamkeit und das Wiedersehen mit seiner Familie lässt ihn ungeduldig die Ablösung erwarten, die in zwei Wochen eintreffen soll. Aber dann hat er während eines Routine-Kontrollgangs mit seinem Mondbuggy einen Unfall – und wacht wieder in der Station auf, ohne Erinnerung wie er zurück gekommen ist. Gegen den Rat seines Computers fährt er noch mal zur Unfallstelle – und findet am Steuer des havarierten Fahrzeugs sich selbst, noch immer bewusstlos über dem Steuer zusammengesunken.
„Moon“ ist das Regiedebüt des Briten Duncan Jones, und wenn wir jetzt kurz erwähnen dass er der Sohn von David Bowie ist, dann reicht das für heute auch schon mit dem Gossip.
Verkneifen wir uns lieber Wortspiele wie, dass der Ziggy ihm wohl den Stardust in die Wiege gelegt hat – obwohl man durchaus darauf kommen könnte, so gekonnt und geschmackvoll wie er sich durch die Geschichte des SF-Films zitiert. Die britische Independent-Produktion mit einem geradezu lachhaften Budget von 5 Mio. Dollar könnte man als so etwas wie die Anti-These zu den sonst im Genre üblichen Reizüberflutungen bezeichnen: Statt bunten Schlachtengemälden zeigt er ein Kammerspiel in klinisch weißen Gängen, statt Haudrauf-Dramaturgie von guten gegen böse Stereotypen, ein versonnenes Verwirrspiel mit einem überragenden Sam Rockwell in einer Doppelrolle im Zentrum.
Dabei ist an „Moon“ wenig wirklich neu. Tatsächlich ist er mit Zitaten und Querverweisen geradezu vollgestopft, dabei zeigt sich aber, dass Jones nicht nur ein Kenner, sondern auch ein Liebhaber des Genres ist. Denn er orientiert sich vor allem an Filmen von zwischen den späten 60ern bis frühen 80ern, der Hochzeit des Genres. Überdeutlich ist der Einfluss von „2001“ zu sehen, aber auch „Alien“, „Lautlos im Weltraum“ „Solaris“ oder „Outland“ haben ihre Marken hinterlassen. Dass das nicht in plumpen Plagiarismus ausartet, liegt vor allem daran, dass der Film nicht versucht seine Vorbilder zu verheimlichen sondern sie immer wieder mit einem Augenzwinkern präsentiert. Vor allem der von Kevin Spacey gesprochene Computer „Gertie“, ein tiefenentspannter Nachfahre von HAL 9000, ist hierfür ein Paradebeispiel: In seiner säuselnden Fürsorge für Sam schwingt immer eine gewisse Ambivalenz mit, die hellhörig werden lässt. Das geübte SF-Publikum weiß: Computer, die so freundlich sind, führen immer etwas im Schilde. Man wartet also darauf, dass das diffuse Gefühl der Bedrohung aufgelöst wird, während sich der Regisseur ins Fäustchen lacht.
Eine Erklärung der seltsamen Vorkommnisse in der Station kommt vergleichsweise früh im Film und ist auch nicht besonders überraschend, was auch der Spannungskurve nicht unbedingt zuträglich ist. Aber Jones geht es auch nicht darum, die Vorgänge der Unterhaltung willen so lange wie möglich zu verschleiern, er spielt mehr mit der üblichen Plot-Struktur des großen Twists und benutzt sie um eine Variation auf klassische Themen der SF abzuliefern; zum Beispiel die Frage nach der Natur der persönlichen Identität, der Isolation des Individuums, und auch dessen Ausgeliefertsein in einem entseelten kapitalistischen System.
All diese Motive hat Sam Rockwell nahezu allein zu tragen, der diese Aufgabe mit Bravour meistert. Seine beiden äußerlich identischen Charaktere entwickeln sich in völlig verschiedene Richtungen, dennoch ist der eine immer im anderen erkennbar. Mit seinem Spiel bringt Rockwell die quälende Einsamkeit der Situation auf den Punkt.
Neben sich selbst hat Rockwell noch Kevin Spacey als Ansprechpartner, der im Original „Gertie“ die Stimme leiht. An der Maschine lässt sich auch schön ablesen, wie überlegt das retromäßige Produktionsdesign die Themen des Films wieder aufgreift. Mit seinem grob personenförmigen Gehäuse und seinem auf Augenhöhe angebrachten Bildschirm, auf dem er mit Smileys drei verschiedene Gemütszustände simulieren kann, ist er für Sam so etwas wie die Mutter-Attrappe für den verstoßenen Jungvogel.
Wer einen in erster Linie spannenden Mindfuck-Thriller im Weltraum sehen will, wird von „Moon“ wohl eher enttäuscht sein. Stattdessen zeigt Duncan Jones einen lange verwaisten Ansatz in der SF, der zeigt, wie stark das Genre sein kann, wenn man es denn nur lässt: nämlich, es als Versuchsanordnung für philosophische Fragen zu benutzen.
Seinen nächsten Film will Jones übrigens in Babelsberg drehen, die Geschichte soll im Berlin der Zukunft spielen. Man darf sehr gespannt sein.