Warst du schon mal in einem Irrenhaus? Nicht wegdrehen, ja, ich meine dich. Ich war schon mal in einem, öfter. Ich meine: in einem richtigen. Ich erinnere mich noch an Vieles, an die vielen Kleinigkeiten, die zahlreichen Details, aber auch an Geschichten, die ich davon erzählen könnte. Begebenheiten, die skuril waren.
House den Lukas: Anruf im Irrenhaus
Aber nur eines ist mir im Kopf als Bild hängengeblieben. Und immer, wenn ich das Wort „Irrenanstalt“, „Irrenhaus“, „Landeskrankenhaus“, „Psychatrie“ oder „geschlossene Abteilung“ höre, dann sehe ich dieses Bild: Menschen, die sitzen oder stehen und apathisch in sich zusammengesunken sind, die sehr gebückt sind. Eine krumme Körperhaltung ist immer ein Zeichen von Traurigkeit oder Hoffnungslosigkeit. Wenn man eine kleine Ansammlung von Menschen sieht, die sich nicht bewegen, nur dastehen und sehr gebückt sind, die auf den Boden schauen – das ist schlimm. Es ist unheimlich. Und es ist real. Weil es kein Horrorfilm mit zielstrebig aggressiven Zombies ist, sondern weil es die Wirklichkeit ist. Glaub mir, das vergisst du nicht.
Strange(rs): Rempeleien in der Nacht
Es ist dunkel, ich gehe zur S-Bahn. Dunkel und kalt. Eine Frau kommt mir entgegen. Sie blickt auf etwas Leuchtendes in ihrer Hand. Ein Schatz? Nein, ein Handy. Oder doch: Ein Gerät, das Versprechnungen macht. „Du bist begehrt, du kennst viele Leute“, verspricht es dir. Die Frau ist groß und gut angezogen. Sie rennt mich fast über den Haufen, weil sie mich nicht sieht. Sie sieht die virtuellen Menschen auf dem kleinen Bildschirm. Mich, hier in der Wirklichkeit, sieht sie nicht.
Neverland: Der Spielplatz-Horror
Heute morgen bin ich über den Spielplatz zum Einkaufen gefahren. Links die zwei Schaukeln mit den nagelneuen blitzernden Ketten. Auf der einen sitzt eine vielleicht Zweijährige, blond, sie lächelt, wippt etwas mit der Schaukel. Links daneben die Mutter, Brille, dunkle Kleidung, krummer Rücken und den Blick nach unten gerichtet. Sie nimmt nichts wahr, mich nicht, die Tochter nicht, sie guckt nur auf ihr Handy. Ich muss daran denken, wie ich gestern im Zug saß. Der war gerappelt voll. Ich am Fenster auf dem Vierer. Es steigt ein Mann zu. Er setzt sich schräg gegenüber. Beim nächsten Halt setzt sich eine Frau dazu, mit ihrem Kind, ein Junge, etwa sieben Jahre alte. Er trägt ein Hörgerät. Etwas ist mit ihm. Die Fahrt mit den beiden dauert etwa eine halbe Stunde. Sie sitzt neben mir. Guckt die ganze Zeit gebückt und wie apathisch auf ihr Smartphone. Sie chattet die ganze Zeit, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Sie sieht nicht einmal auf, sieht nicht ihren Sohn an, richtet kein Wort an ihn. Auch er bleibt stumm. Er sitzt mir gegenüber am Fenster. Er wirkt sympathisch auf mich.
Aufmerksamkeitsdefizit: Missachtung als Erziehungsmethode
Der Zielbahnhof der beiden. Die Frau steht auf, geht wortlos vor. Es gibt irgendein Missverständnis zwischen den beiden. Der Junge sagt etwas, er ist sprachbehindert. Ich hab nicht hingehört, war in Gedanken bei einem meiner Irrenhausbesuche. Er steht nicht schnell genug auf. Die Mutter raunzt ihn an, er solle jetzt endlich kommen, er solle sich beeilen. Nicht gerade eine nette Stimme, eine herrische, unfreundliche. Die Frau steht im Gang, hinter den anderen Wartenden, sie blickt gebückt wie hypnotisiert auf das Display ihres Handys. Sie wendet ihrem Sohn den Rücken zu. Der steht mit etwas Abstand hinter ihr. Sie kommuniziert mit einer Maschine.
The End: Das leere Handy-Deprislay
Als ich auf dem Rückweg wieder über den Spielplatz fahre, sitzt das Kind mit einem anderen gleichaltrigen Kind im Sandkasten, sie spielen zufrieden. Die Mutter guckt kurz hoch als ich vorbei fahre. Sie guckt so ernst, als spiegelte sich ihre Depression im Display des Handys.
Gestern habe ich mir ein Smartphone bestellt.

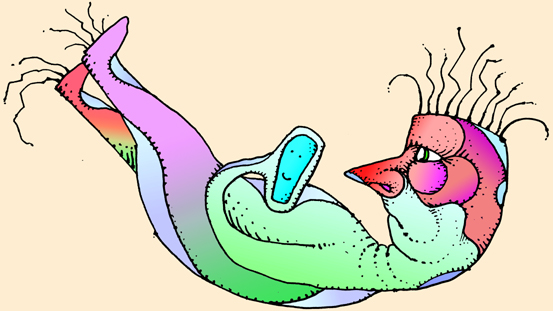

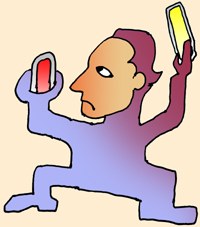

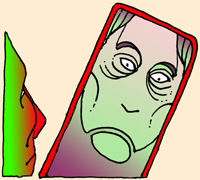

2 Responses to “Tagebuch/23. November 2013: Die Smartphone-Depression”
[…] Die Smartphone-Depression: Ein Schatz? Nein, ein Handy. Oder doch: Ein Gerät, das Versprechnungen macht. “Du bist begehrt, du kennst viele Leute”, verspricht es dir … endoplast […]
[…] kann man wohl kaum verdeutlichen, wie sehr neue Technik der Flucht in virtuelle Welten und der Kommunikationslosigkeit dient. Qualitative Kommunikation wird gegen viel Plapperei eingetauscht. […]