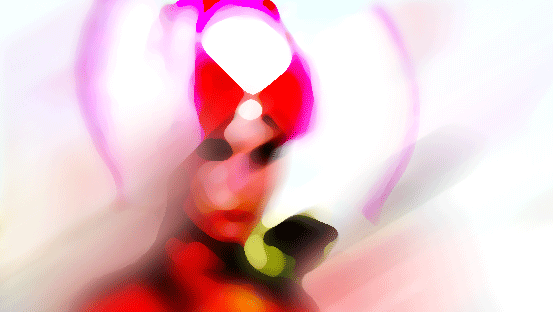
Unsichtbares darzustellen ist die Kunst dieses Regisseurs. Sein erster Film war vielbeachtet, der zweite weniger. Jetzt arbeitet er an seinem dritten.
2006 war nach „The Cell“ der lang erwartete zweite Film des Regisseurs Tarsem Singh (der sich „Tarsem“ nennt), „The Fall“, zögerlich in die Kinos in Amerika und Großbritannien gekommen und erst 2009 in Deutschland auf DVD veröffentlicht worden. Ende September war nun eine luxuriöse Version des Filmes als kombinierte DVD/Blue Ray erschienen. Ein Teil der Kritiker hat den Film als schön aber hohl klassifiziert. Doch der Film hat eine außergewöhnliche erzählerische Konzeption.
Wer hin- und wieder ins Kino geht oder öfter fernsieht, wird die Arbeiten des Regisseurs Tarsem kennen. Er ist Werbefilmer und Regisseur von Musikvideos. Er hat für zahlreiche internationale Marken gearbeitet, zum Beispiel viel für die Automobilindustrie, und ist mit seinen Jeansspots, die er in den 90ern für die Londoner In-Agentur BBH kreiert hat und die inzwischen als Klassiker gelten, zum Werbe-Olymp aufgestiegen.
Tarsem Singh als ernsthafter Filmemacher
Sein erster Spielfilm, „The Cell“, der 2000 in die Lichtspielhäuser kam und ein zufrieden stellendes Einspielergebnis erzielt hatte, wurde von der Kritik relativ positiv beurteilt. Sechs Jahre später folgte „The Fall“, der nicht flächendeckend ins Kino kam – weder in Amerika noch in Europa. Es war sogar lange Zeit fraglich, ob er überhaupt gezeigt werden kann. Der Film ist zu skuril, zu künstlerisch, zu langatmig, zu zielgruppenungenau – weder ein reiner Kinderfilm, weil zu gewalttätig, noch ein reiner Erwachsenenfilm, weil zu versponnen und über weite Strecken aus der Perspektive eines Kindes erzählt.
„The Cell“: Die Antwort auf Hannibal Lecter
Als 1991 das zwei Jahre zuvor erschienene Buch von Thomas Harris „Das Schweigen der Lämmer“ verfilmt wurde, war damit für die Film-Gemeinde eine neue Verkörperung des „Bösen“ gefunden, wie es sie nur äußerst selten gibt. Hannibal Lecter war als hoch intelligenter Serienkiller gespielt von Anthony Hopkins ein Ereignis, das den bisherigen Klischees entkam. Ein Glücksfall war zudem die kongeniale Verfilmung des Buches, die ein Optimum aus dem Stoff herausgeholt hatte.
Danach stellte sich die Frage, ob diese Darstellung des Bösen und seiner Hintergründe noch zu übertreffen sein könnten. Tarsem ist dies mit „The Cell“ auf eine kluge Art bereits relativ schnell gelungen – was einen Teil der Faszination für diesen Film ausmacht.
Der Serienkiller-Plot aus einer anderen Perspektive
Tarsem hat seine Story ebenfalls rund um einen Serienkiller aufgebaut und dadurch die Grundspannung erzeugt. Der Killer zeichnet sich durch seine Perversionen aus, ist aber als Mensch ein unbeschriebenes Blatt. Nach und Nach wird der Zuschauer mit seiner Innenwelt konfrontiert. Die Psychologin, glaubwürdig gespielt von Jennifer Lopez, kann mittels einer neuen Technologie in die Gedankenwelt des Mörders vordringen. Dort wird sie mit dessen Kindheitsgeschichte und seinen Motivationen konfrontiert. Es findet eine Reise in seine Psyche statt, die zeigt, warum dieser Mensch zum wahnsinnigen Mörder geworden ist.
Dieses erzählerische Mittel – nicht nur die Bösartigkeit als absolut in der Mittelpunkt zu rücken, sondern das Bösartige und seine Ursachen detailliert, glaubwürdig und surreal zugleich darzustellen, wie man das bis dahin nur selten gesehen hatte – weist über „Das Schweigen der Lämmer“ hinaus.
Die Vorhaltungen manchen Kritikers, „The Cell“ sei nur ein weiterer Film über einen Massenmörder, gehen an der Sache vorbei, weil Tarsem dem Genre etwas Neues hinzugefügt hat, indem er das Bizarre des Mörders nachvollziehbar aufschlüsselt und erklärt.
Wikipedia schreibt über die Kategorisierung von „The Cell“, es handele sich um einen „Science Fiction“-Film, wohl weil der Film in dieser Kategorie eine Auszeichnung bekommen hat. Diese Einordnung ist aber fragwürdig. Der Film enthält fantastische Momente, die sich jedoch der üblichen Kategoriesierung entziehen. Es handelt sich eher um einen Kriminalfilm mit fantastischen Elementen. Wissenschaftliches als Science-Element dominiert den Film aber nicht.
Die Rezeption von „The Fall“
An „The Fall“ wurden das Drehbuch und ein Mangel an Substanz kritisiert. Die Substanz-Kritik geht jedoch weitestgehend ins Leere. Gerade seine Inhalte sind die Stärke des Films, allerdings fällt er durch etablierte Kritikerraster.
Für Mainstream-Kritik ist er deutlich zu langatmig und in der Story wenig spektakulär. Der Film verzichtet – vermutlich aus Budgetgründen – auf aufwendige Action-Szenen und auf spektakuläre Effekte. Auf digitale Nachbearbeitung wurde lediglich zurückgegriffen, um störendes Beiwerk, das z.B. Bauwerke visuell beeinträchtigt hat, wegzuretuschieren oder um die Ausstattung des Filmes zu ergänzen.
Die Hochkultur-Kritik wird es einem Werbeclip-Regisseur nicht leicht machen, zumal, wenn er seine kommerzielle Ästhetik auf einen Spielfilm übertragen will.
Tarsem Singh: Genie und Selbstverrat?
Im internationalen Werbefilm ist Tarsem erfolgreich, zeichnet sich durch Ideenreichtum aus. Andererseits erscheint er als Verräter an seinen Möglichkeiten, indem er sich um Film nur nebenbei kümmert und hauptberuflich seine hohlen Werbeclips dreht. Seine bisherige Ausbeute ist mager: Mit „The Cell“ lediglich ein außergewöhnlicher Erstling und mit „The Fall“ ein nicht ausgegorener Nachfolger, der an seinem Anspruch scheitert.
An „The Fall“ hat Tarsem vier Jahre gedreht und von der Idee bis zur Realisierung 15 Jahre gebraucht. Und trotz all der investierten Zeit: Zu unklar und langatmig die Erzählung, zu clean ausgeleuchtet die Bilder und zu abgehackt in seiner der Musikvideo-Ästhetik verwandten Aneinanderreihung visueller Höhepunkte. Warum der Regisseur – wie man so schön sagt – auf hohem Niveau gescheitert ist, wird im Folgenden näher erläutert.
Der Unterschied: Werbefilme und Spielfilme
Zum Verständnis sind zunächst die Unterschiede zwischen Werbe- und Spielfilmen zu betrachten. Die meisten Werbefilme, die Tarsem gedreht hat, sind zwischen 30 und 60 Sekunden lang. In dieser Zeitspanne hat er sein Publikum mit einer aufmerksamkeitsstarken Geschichte zu fesseln. Nicht viel Zeit. Komplexe Handlungen sind da ausgeschlossen. Es geht beim Werbefilmen meist um die Kunst des Weglassens, um die Reduktion auf das Wesentliche. Eine Herleitung komplexer Zusammenhänge ist da nicht vorgesehen.
Der Werbespot ist vergleichbar mit einer Kurzgeschichte, der Spielfilm mit einem Roman. Inzwischen erfolgreiche Kinoregisseure wie David Fincher („Alien III“, „Fight Club“, „Panic Room“, „Zodiac“, „Der seltsame Fall des Benjamin Button“) haben in der Werbung angefangen – aus Kommerz ist hier zum Teil Filmkunst geworden.
Erfordernisse zwischen Schnelligkeit und Langsamkeit
Geht es bei kurzen Filmen darum, durch das Weglassen von Details ohne Umschweife auf den Punkt zu kommen, beschleunigt zu fesseln und schnell zu kommunizieren, geht es beim Spielfilm um die Entwicklung der Geschichte und Handlung in größeren Spannungsbögen, die Handlung kann verschachtelt und komplex, der Detailreichtum größer sein. Werbefilme sind eher rhythmisch, Kinofilme eher episch, das heißt, sie haben in der Regel einen langsameren Erzählfluss.
Werbefilmer müssen Perfektionisten sein. Da sie kommunikative Miniaturen produzieren und jede Sekunde bei der Ausstrahlung des Spots im Fernsehen Geld kostet, liegt die Kunst des Werbefilms in der Konzentration auf das Wesentliche. Jede Bewegung, jeder Gesichtsausdruck, jeder Schnitt muß perfekt sitzen. Wer aber die Prinzipien der Werbespots auf einen Langfilm übertragen will, wird dramaturgische Probleme bekommen. Zu starrer Perfektionismus führt nur zu Künstlichkeit – erst Recht beim Spielfilm. Und Detailversessenheit, die bei Werbespots unerlässlich ist, vernebelt beim Kinofilm unter Umständen nur den Blick: Für Spannungsbögen, den Fluß der Handlung, für Folgerichtigkeit und das richtige Tempo. Denn daran krankt „The Fall“.
Wo bleibt der Blick für’s große Ganze?
Tarsems Perfektionismus zeigt sich überall bei diesem Projekt: Jahrelang hat er Drehorte auf der ganzen Welt gesucht. Die Kinder-Hauptdarstellerin mußte er natürlich im angeblich aufwendigsten Casting der Filmgeschichte suchen und finden. Sein Anspruch war denkbar hoch: Eine neue Bildsprache zu entwickeln und eine völlig neuartige Story zu bringen. Die Bildsprache erinnert dabei jedoch stark an seinen Erstling, die Story ist aber durchaus außergewöhnlich in ihrer Vielschichtigkeit.
Ein Werbeclip-Regisseur, der seine Vorgehensweise auf einen Kinofilm übertragen will, läuft Gefahr, spektakuläre Szenerien aneinanderzureihen und dafür den Zusammenhalt des Filmes zu opfern. In „The Fall“ wird die unspektakulär gefilmte Normalwelt, die in stumpfen, monochromen Farben gezeigt wird, kontrastiert mit einer schillernden, bunten Fantasiewelt.
„The Fall“: Die Story zählt
Wer Werbefilme gedreht hat, kann weiteren Gefahren zum Opfer fallen: Vielleicht neigt er dazu, endlich das machen zu können, wozu er nie die Gelegenheit hatte: Komplex und mit viel Zeitbedarf die Handlung zu entwickeln, was aber unter Umständen Langeweile erzeugen kann, wenn man’s übertreibt. „The Fall“ hat denn auch beide Fehler gemacht: Der Rhythmus der Märchen-/Traumsequenzen mit immer neuen Locations ist zu kleinteilig, die Erzählung insgesamt aber zu langatmig. Das hatte Tarsem bei „The Cell“ homogener und kurzweiliger gelöst.
Die Actionszenen sind z.T. etwas behäbig gefilmt und wenig spannend geschnitten, die Märchensequenzen zu konkret gefilmt. Das Intro des Films in seiner Zeitlupenoptik, seiner relativen Unschärfe und verzögerten Dynamik wirkt da fast märchenhafter obwohl es darin um die Realität geht. „The Cell“ war, was den Surrealismus der Bilder anbelangt, wesentlich weiter gegangen. Schön gefilmt sind hingegen die „The Fall“-Sequenzen in der realen Welt, meist in einem Krankenhaus. „The Cell“ bleibt aber das geschlossenere Werk, letztlich auch der Film, der besser funktioniert. „The Fall“ hat höhere Ziele, die aber nicht immer erreicht werden. Er überzeugt durch die außergewöhnliche Story und durch seine Vielschichtigkeit.
Figuren und Protagonisten, Landschaften und Charakterzeichnungen
Der Star in „The Fall“, denkt man manchmal, sind neben den beiden Titelfiguren die zahlreichen Locations, die permanent gewechselt werden. Der Film wirkt stellenweise wie ein Reise- oder Kulturführer. Andererseits bleibt zu wenig Platz für die Entwicklung der eigentlichen Hauptfiguren, die etwas aufgesetzt zwar vorgestellt werden aber keine weiteren Eigenschaften zu haben scheinen. Sie als reine Funktions-Symbolfiguren zu belassen, funktioniert aber nicht.
Die Charakterzeichnung erscheint schwach, wobei das Argument, Traumfiguren seien eben so eindimensional, nicht ziehen würde. Der Zuschauer muß jede wichtige handelnde Figur nachvollziehen können, entweder aus Gründen der emotionalen Identifikation oder aus Gründen des intellektuellen Zugangs. Es liegt der Verdacht nahe, dass der Regisseur sich bezüglich der Gesamtlänge des Filmes entscheiden mußte zwischen den grandiosen Kulissen und Locations einerseits, deren Darstellung und Entfaltung er viel Zeit und Kameraeinstellungen gewidmet hat, und andererseits gegen die Personenzeichnung. Beides zusammen hätte vermutlich zuviel Zeit gekostet.
Hier scheint der profunde Clipfilmer nicht den Anforderungen an die zeitliche Ökonomie eines Kinofilmes gerecht geworden zu sein. Er wollte seine Einstellungen aus 18 Ländern unterbringen und gab ihnen soviel Raum, dass sie den Film fast zum Bersten bringen.
Fluch und Leidenschaft: Leben mit der Werbung
Tarsem jettet durch die Welt und verkauft seine Künstlerseele an die Werbung. In den 15 Jahren, die er an „The Fall“ gearbeitet hat, hätte er seine einmalige Filmsprache weiterentwickeln können. Hat er seine künstlerischen Ambitionen hintangestellt? Sein Bruder, der den Film mit produziert hat, mußte ihn sogar dazu drängen, den Film „The Fall“ endlich konkret anzugehen, damit das Projekt nicht im Sande verläuft. So ist das, wenn man ein gesuchter Werbefilmer ist.
Auch andere gestandene Regisseure haben umgekehrt den Weg in die Werbung gefunden und damit ihre künstlerische Laufbahn sabotiert. Zum Beispiel der ansonsten kommerziell völlig unverdächtige David Lynch, von dem man immer weniger hört in Sachen abendfüllendem Film. Seinen letzten Film „Inland Empire“ hat er gerade so zustande gebracht. Dafür dreht er Videos und Features.
Realität und Traum als Doppelwelten
Nach all der Kritik: Was spricht für „The Fall“? Der Sinn der Geschichte, der Inhalt vor allem, die schauspielerischen Leistungen und die grandiosen Bilder. Schon „The Cell“ war beeindruckend in seiner Darstellung der Innen- und Gedankenwelt eines Mörders. „The Fall“ verschränkt die Traumwelt des Filmemachens – der Protagonist ist ein verunglückter Stuntman – mit der Traumwelt eines Kindes und der eines Geschichtenerzählers. Der gelähmte Stuntman nämlich erzählt dem Kind eine Geschichte, die es dazu bringen soll, dass es ihm eine Flasche mit Morphium bringt, mit der er sich umbringen will, weil er verzweifelt ist.
Scheitert der Film an der Ausführung so hat er konzeptionell viel zu bieten: Kunstvoll, folgerichtig und zwingend sind Wirklichkeit und Traumwelt ineinander verschränkt. Dies wird unterstützt von einem außergewöhnlichen schauspielerischen Miteinander vor allem der beiden Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller von „The Fall“ spielt einen Stuntman, der einen Filmstar doubelt, der seine Freundin heiratet, woran der Stuntman verzweifelt. Der zu drehende Stummfilm in „The Fall“ ist als zweite Handlungsebene etabliert. Hinzu kommt aber eine traumhafte Ebene, die aus der Erzählung des Stuntmans und dem Zuhören eines kleinen Mädchens besteht. Dies erinnert an „Tausend und eine Nacht“.
Schauspieler auf doppeltem Boden
Dies sind wohlweislich zwei Phantasieebenen, die wiederum erkennbar getrennt voneinander aber ineinander verschränkt sind – ein außergewöhnlich ambitioniertes Konzept. Des weiteren hat jede der wesentlichen handelnden Figuren eine Entsprechung auf der Ebene der Imagination – jeder Schauspieler spielt also eine Doppelrolle. Die Wirklichkeit wird vom Stuntman in seinen Erzählungen und vom Mädchen in den Figuren der Fantasie verarbeitet. Der Regisseur zeigt auf eine eindringliche und nachvollziehbare Weise, wie Begebenheiten in der Wirklichkeit dort, in der Welt der Fantasie, ihre Entsprechung finden. Wie dies geschieht, ist eine besondere Leistung des Filmes.
Ein „Seepferd“: Das lyrische Intro
In der Eröffnungssequenz von „The Fall“ werden die Auswirkungen des Unfalls am Filmset gezeigt. Ein Pferd ist von der Brücke ins Wasser gefallen. Man will es an einem langen Seil aus dem Wasser auf die Brücke hochziehen. Als das Pferd in der Luft hängt, endet die Einstellung – ein seltsam surreales Bild und ein Symbol dafür, wie das Fantastische Einzug hält in die reale Welt in der Schwebe zwischen der Realität des verunglückten Stuntmans, der auch unten im Wasser schwimmt, und der Realität des Filmteams hoch oben auf der Brücke.
Wie ist der Film entstanden?
Tarsem hat als Werbefilmer international zu tun. An manchen Drehorten, an denen kommerzielle Werbeprojekte entstanden sind, hat er direkt einen Teil von „The Fall“ gedreht. Tarsem sagt dazu: „Immer wenn ich einen Werbespot drehte, machte ich Fotos [der Locations]. Ich sagte zu den Leuten am Set: Das hier ist ein bezahlter Job. Irgendwann werde ich mich aber vielleicht wieder bei euch melden und euch bitten, euch dafür zu revanchieren. Eine Menge Leute haben sich revanchiert. Immer wenn wir einen Spot fertig hatten, versuchten wir, ein paar Szenen für „The Fall“ zu drehen.
Diese Arbeitsweise hat zusätzlich zu mangelnder Homogenität geführt.
Tarsem arbeitet inzwischen an seinem dritten Film „Dawn of War“, einer Game-Adaption. Ob er sich damit einen Gefallen getan hat?
