Jede Wahl bringt nur Gewinner hervor, es ist eine Frage des Blickwinkels: Da gibt es Überraschungs-Gewinner, Gewinner trotz widerigster Umstände, Achtungs-Gewinner oder Verhältnismäßigkeits-Gewinner. Man kann es drehen und wenden, bis ein Verlierer zum Gewinner wird.
Dabei ist im Laufe der Wahlen in diesem Jahrzehnt immer mehr einer ins Hintertreffen geraten: Der eigentliche Gewinner. Wer ist das? Der, der die meisten Stimmen erhalten hat? Ja.
Und noch ein anderer? Ja: Der, der den größten Sprung gemacht hat. Der, der tendenziell an Gewicht zunimmt in einer bisher einfach strukturierten Parteienlandschaft, in der nur ein paar ihren festen Platz hatten. Wer von wenigen Prozenten im Laufe der Jahre auf viele Prozente kommt und sich schließlich eine neue politische Kraft etabliert: Das mag dann derjenige sein, der die Zukunft gewinnt.
Ein Blick in die Vergangenheit: Fast die ganzen 80er- und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts standen unter der Bundeskanzlerschaft von Helmut Kohl. Die lange Amtszeit mit personeller Kontinuität schluckte viel politische Dynamik. Bereits 1990 war Oskar Lafontaine Kanzlerkandidat der SPD und wollte das ändern.
Vier Jahre später trat zwar Rudolf Scharping an, war jedoch medial flankiert von Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine in der so genannten „Troika“. Der politische Leidensdruck war in dieser Zeit imens, umso mehr war enttäuschend, dass Kohl sich wieder durchsetzen konnte. 1998 wurde Gerhard Schröder endlich SPD-Kanzler mit dem Finanzminister Lafontaine.
Doch bereits kurz danach, im März 1999, legte Lafontaine alle politischen Ämter nieder. Er galt schon seit seiner sehr erfolgreichen Zeit als Ministerpräsident im Saarland als sog. Vollblutpolitiker. So verfügt er über ein ausgeprägtes Sendungsbewußtsein. Er ist der Schumi der Politik, er schöpft alle Mittel aus, er hat den so genannten Machtinstinkt. Hinzu kommt, dass er ein Gegenmodell zu Schröder war, ein linker Politiker, der auch links denkt.
Die Differenzen mit Schröder und der SPD hat er damals persönlich genommen. Das Ausscheiden aus der SPD war begleitet von Reibereien, die Jahre nachhallten. Man kann es verobjektivieren: Das, was an der SPD nicht stimmte, konnte er aus persönlicher Betroffenheit verinnerlichen – und gähren lassen. Diese Gegenposition wird im Laufe der Jahre an Kontur gewonnen haben. So konnte ein politisches Gegenmodell wachsen, das schließlich erst 2007 mit „Die Linke“ eine vermittelbare Form angenommen hat.
Das Sendungsbewußtsein sowie die Betroffenheit Lafontaines und der Erneuerungsbedarf der SPD haben mit zu einer neuen politischen Kraft geführt, die dabei ist, sich zu etablieren. Die Linke ist der Überraschungs-, der Achtungs- und der Verhältnismäßigkeitsgewinner. Ihr klares Profil macht die Partei zum Machtfaktor, der jetzt in Koalitionsverhandlungen eintreten kann.
Wer hätte das gedacht nach dem Ausstieg Lafontaines vor 10 Jahren? Wut kann auch eine Art der Leidenschaft bewirken. Die Wut sollte vergehen und die Leidenschaft ansteckend wirken.

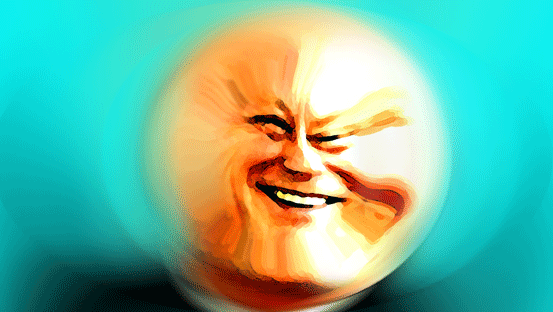
3 Responses to “29. August: Lafo schlägt zurück”
[…] ist angezapft. Die Stärke der Linken liegt in ihrer profilieren Gegenposition. Oskar LaFontaine und Gregor Gysi haben kaum mehr zu bieten als ein soziales Gewissen, das jedoch in Zeiten der […]
[…] Weitere Artikel über Die Linke und Oskar Lafontaine auf Endoplast: – Lafontaine übt Kritik im Bundestag – NRW-Wahlkampf: Die Linke mit Lafontaine in Essen – NRW-Wahlkampf: Linke Sozialpolitik als Alleinstellungsmerkmal – Lafontaine’s Comeback:Lafo schlägt zurück […]
[…] Jene SPD, aus der seinerzeit die meisten linken SPD-Abgeordneten ausgetreten waren um in die Partei „Die Linke“ einzutreten. Zurückgeblieben ist eine SPD, die zwar noch „SPD“ heisst aber nichts mehr mit […]