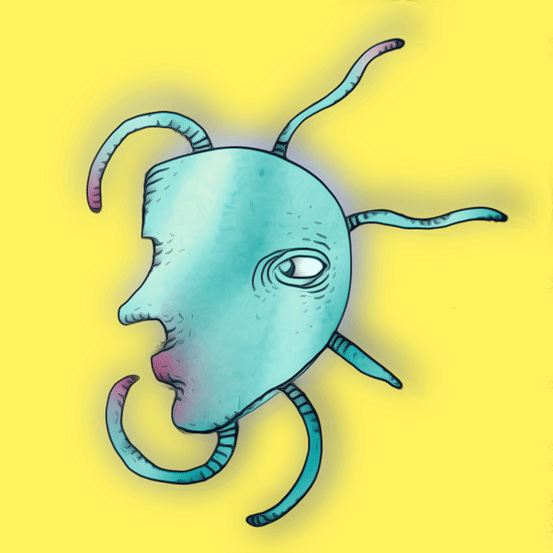 Die unüberschaubare Vielfalt der Wirklichkeit und ihre sich gegenseitig bedingenden Abläufe haben einen trivialen gemeinsamen Nenner: dass etwas „ist“, „verläuft“ oder „abläuft“. Dass also etwas überhaupt vorhanden ist, geschieht und nicht etwa nichts ist und nichts passieren würde. Es „ist“ etwas, so wie auch der Mensch vorhanden „ist“. Er tut etwas und ist damit letztlich ein Rad im Getriebe der unüberschaubaren Ursache-/Wrkungs-Mechanismen der Wirklichkeit. Aber welche Rolle spielen Zustände oder Denkmodelle wie „Das Sein“ und „Das Nichts“ in der Kunst?
Die unüberschaubare Vielfalt der Wirklichkeit und ihre sich gegenseitig bedingenden Abläufe haben einen trivialen gemeinsamen Nenner: dass etwas „ist“, „verläuft“ oder „abläuft“. Dass also etwas überhaupt vorhanden ist, geschieht und nicht etwa nichts ist und nichts passieren würde. Es „ist“ etwas, so wie auch der Mensch vorhanden „ist“. Er tut etwas und ist damit letztlich ein Rad im Getriebe der unüberschaubaren Ursache-/Wrkungs-Mechanismen der Wirklichkeit. Aber welche Rolle spielen Zustände oder Denkmodelle wie „Das Sein“ und „Das Nichts“ in der Kunst?
Das gedachte „Nichts“ wäre in Bezug zum Menschen das „Nicht-Lebendige“, der „Tod“, auch das „Nicht-Sein“, das „Nicht-Seiende“ oder das „Nicht-Existente“. Jedenfalls wäre eine Teilmenge davon zugleich das „Nicht-Lebendige“. Etwas zu tun, zu empfinden und zu denken ist aus Sicht des Menschen in Bezug zum gedachten „Nichts“ der absoluten „Inaktivität“ und des „Nicht-Vorhandenseins“ der Dinge sowie des Denkens, Fühlens, Lebens und Lebendsigseins zu setzen und an ihm zu messen.
„Sein“ und „Vielfalt“ als Gegensätze des „Nichts“
Was immer also das unvorstellbare „Nichts“ sein mag, es hat im Bezug zum menschlichen „Sein“ eine Art Referenzstatus, es ist eine Bezugsgröße, sogar eine relative Messgröße der eigenen Aktivität und der Beschaffenheit dieser Aktivität. So wäre „Vielfalt“ als Teilmenge des „Alles“ etwa das gelebte Gegenteil des „Nichts“ – wie auch das bloße „Sein“ als ein anderes Gegenteil des „Nichts“ aufgefasst werden könnte.
Das „Nichts“ als sich entziehende Bezugsgröße
Hier ist vom totalen „Nichts“ die Rede, also von einem Zustand, in dem überhaupt nichts vorhanden wäre oder – wie es die Physik mutmaßt – doch etwas sehr Kleines vorhanden sein könnte, etwa Wellen und ihre Schwingungszustände, die in der Folgezeit aus dem Nichts heraus dennoch etwas erschaffen könnten, etwa ein ganzes Universum. Redet man aber vom umfassenden, absoluten und totalen „Nichts“, so kann man nahelegen, dass dies für ein gelebtes Leben eher als Denkmodell dient, nicht als reale Gegebenheit und noch nicht einmal als theoretische Möglichkeit, weil das Nichts nicht gedacht, vorgestellt oder erlebt werden kann.
Das empfundene „Nichts“
Aber in jedem Leben gibt es das Empfinden für ein anderes, konkreteres „Nichts“. Etwa wenn alles zusammenbricht, was man in seinem Leben geschaffen hat, durch eine Naturkatastrophe, den finanziellen Niedergang, durch Tod oder Krankheit. Dann sagt man retrospektiv, auch wenn es weitergegangen und man dem vermeintlichen „Nichts“ entkommen ist: „Ich stand damals vor dem Nichts“. Es geht bei diesen Beispielen nicht um ein „Nichts“ als Denkkonstrukt, im Grunde geht es im eigentlichen Sinne nicht um ein „Nichts”, sondern um ein reduziertes „Etwas“, also etwas, was weniger geworden oder nicht mehr da ist. Ein Mensch, der im Sterben liegt, lebt immer weniger, bis er tot ist. Ein Fluss kann versiegen, Geld, das ausreichend vorhanden war, kann immer weniger werden, bis kaum noch genügend da ist, mit Folgen für eine ehemals bürgerliche Existenz.
Das subjektive „Nichts“
Es geht hier also nicht um ein objektives „Nichts“, sondern um etwas, das gemessen an den eigenen Ansprüchen lediglich als ein „Nichts“ empfunden wird. Daran ist zu erkennen, dass es für ein gelebtes Leben wichtig ist, einen Zustand zu erreichen und ggf. beizubehalten, damit das Leben als Leben empfunden werden kann. Auch allein die Suche nach etwas bzw. die Zielanstrebung oder Zielerreichung ist ein „Etwas“, also etwas, das das Leben ausmacht. Viele kleine empfundene „Nichts“ können ein Leben prägen: Das Ende einer Beziehung, der Wegzug in die Einöde oder in ein Umfeld, in dem man keinen Menschen kennt, persönliche Isolation oder Krankheit. Was wäre mit einem Patienten, der jahrelang im Koma liegt und dann erwacht? War dieser Zustand für ihn ein „Nichts“ bzw. würde er diese Zeit im Rückblick als ein „Nichts“ empfinden? Solche empfundenen „Nichts“-Zustände sind relative „Nichts“, menschliche „Nichts“, Nullzustände der Inaktivität oder Zustände der Abflachung des Lebens und seiner Umstände und Gegebenheiten.
Kunst und Motivation
Was wäre das „Nichts“ in der Kunst? Künstler reden manchmal davon, dass ihr Werk „automatisch“, ohne eigenes Zutun entstanden wäre. Romanautoren sehen sich manchmal wie Empfänger von etwas, das sie nur noch zu Papier bringen müssen. Sie beschreiben diesen Zustand als etwas, bei dem ihre Romanfiguren ab einem gewissen Punkt ein Eigenleben entwickeln würden und ihnen, den AutorInnen sagen würden, wie es weitergehen soll. Was hier wie ein Automatismus geschildert wird, hat auch eine andere Seite. Denn man kann annehmen, dass es für jedes Verhalten und jede Aktivität eine Motivation gibt. Man könnte etwa Künstler werden, um sich auszudrücken, um etwas zu visualisieren, das in einem schlummert, um etwas zu verarbeiten oder um berühmt zu werden und viel Geld zu verdienen. Zugleich muss man aber nicht zwangsläufig wissen, warum all dies da ist und wo die Suche danach hinführen könnte. Man könnte Kunst kreieren, um Menschen politisch oder sozial zu beeinflussen, indem man sie verunsichert und ihre Wahrnehmung in Frage stellt. Auch etwas darüber auszusagen, was man selbst wahrnimmt, empfindet oder als Auftrag der eigenen Tätigkeit empfindet, kann eine Motivation sein. All dies und viele weitere Motive, um Kunst zu schaffen, sind ein „Etwas“, also viel mehr als ein potenziell empfindbares „Nichts“.
Das „Nichts“ in der Kunst
Das „Nichts“ in der Kunst wäre demgemäß, nichts zu wollen, nichts zu erreichen, leer zu sein, kein zu ermittelndes Motiv zu haben, sondern Kunst als einen Ausdruck zu schaffen, der etwas offenbart, was scheinbar gar nicht da war, nicht vorhanden war, nicht existierte. Dieser angenommene Zustand wäre so, als wäre man selbst ein leeres Blatt Papier und würde eine Zeichenfeder nehmen, um es mit einer Zeichnung zu füllen. Indem die Zeichnung entsteht, wird aus dem relativen „Nichts“ der eigenen Absichtslosigkeit ein „Etwas“. Wo vorher „nichts“ war, dann ein leeres Blatt, das man aus dem Blickwinkel eines künstlerischen Werkes immer noch als relatives „Nichts“ bezeichnen könnte, liegt nun ein Blatt mit einer Zeichnung, also einer Manifestation von etwas, dessen Existenz man vorher nicht angenommen hat oder gar nicht annehmen konnte.
Kunst als Automatismus der Selbstvergessenheit
Im „Werden“ ist aus dem „Nichts“ ein „Etwas“ geworden. Indem man weiter zeichnet, wird aus dem empfundenen „Nichts“ eine zeichnerische Vielfalt, ein ganzes Werk. All dies kann idealerweise in einem Zustand innerer Versenkung oder Meditation geschehen, in dem der in sich Versunkene motivlos und damit absichtslos agieren würde. Der ideale Prozess der Kreation von Kunst wäre dann eine Art Automatismus, dessen Ziel und Ausgang nicht vorauszusehen wären. Dabei muss der Vorgang innerer Abgeschiedenheit in der Praxis gar nicht absolut sein. Er mag vielmehr eine Interaktion zwischen Bewusstsein und Unbewusstem zur intervallmäßig verlaufenden und sich ergänzenden Absicht und Absichtslosigkeit sein. Was zählt, ist, dass Kunst ein Gegenentwurf zum empfundenen „Nichts“ ist, dass dieses angenommene „Nichts“ aber dennoch Kunst als Manifestationsform bedingt – vielleicht, weil ein angenommenes „Nicht“ für den Menschen nur schwer erträglich ist und er das grundsätzliche Bestreben verkörpert, das „Nichts“ zu füllen.
Das „Nichts“ oder das „Nicht-Nichts“?
Die Auffassung, dass das „Nichts“ ein Urgrund der Kunst sein könnte, also quasi der Auftrag ist, aus dem „Nichts“ etwas entstehen zu lassen, kann als Denkalternative zu der Ansicht gesehen werden, dass ein Künstler wie ein Ballon ist, der sich mit Eindrucken füllt, um sie verschränkt, gemixt, gefiltert und angereichert um Elemente seiner eigenen Existenz zu Kunst werden zu lassen. Nach dieser Sichtweise wäre Kunst ein Transformationsprozess, der aus „Etwas“ ein anderes „Etwas“ macht. Vermutlich ist das Entstehen einer eigenen Ästhetik als Ausdrucksform im Wechselspiel beider Mechanismen zu sehen. Dabei wäre das „Nichts“ so bedeutsam wie das „Alles“, die das „Sein“ über die sich aufspreizende Formenvielfalt nachempfinden.

One Response to “Kunsttagebuch: Die Absichtslosigkeit, das Sein und das Nichts”
[…] Kunsttagebuch: Die Absichtslosigkeit, das Sein und das Nichts … endoplast […]